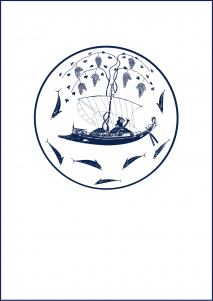Zum 100. Geburtstag von Gilles Deleuze stellt dieses Schwerpunktheft zwei Schlüsselbegriffe seiner Prozessphilosophie in den Mittelpunkt: Zeit und Werden. Deleuzes vielschichtige Konzeption der Zeit, die er entlang der Begriffe Differenz und Wiederholung entwickelt, sowie die verschiedenen Weisen des Werdens, die er besonders in den gemeinsam mit Félix Guattari verfassten Werken thematisiert, verbinden Metaphysik, Ästhetik, Ethik und Politisch-Soziales. Die Beiträge des Heftes zeigen die fortdauernde Vitalität dieses Denkens auf und suchen es in Antwort auf unsere Gegenwart zu aktualisieren. Sie befragen Konzeptionen des Fortschritts, der Evolution, des Anders- und postkolonialen Werdens sowie die Entwicklung neuer Bildtypen in der Konvergenz von Film und anderer audiovisueller Medien.
Inhalt
Schwerpunkt
Marc Rölli Zusammenfassung In den zeitgenössischen Diskursen der politisch engagierten Ästhetik ist das Konzept des Anders-Werdens (Becoming-Other) omnipräsent. Félix Guattari und Gilles Deleuze haben es zuerst in Tausend Plateaus (1980) entwickelt. Von dort herkommend, wurde es in den Künsten und im Feld der neueren Kulturwissenschaften aufgenommen. Es verbindet sich mit unterschiedlichen begrifflichen Varianten des Werdens: vom Unwahrnehmbar-Werden über das Minoritär-Werden und Tier-Werden bis zum Revolutionär-Werden. Seine zeitphilosophischen Hintergründe liegen in Deleuzes Philosophie der Wiederholung und lassen sich im Kontext der neuerdings wieder vermehrt gestellten ontologischen Fragen im sogenannten Neuen Materialismus akzentuieren. Mit ihm werden darüber hinaus Fluchtlinien und Zonen der Inkommunikabilität adressiert, die auf die Machtverhältnisse der Netzwerklogiken von Kontrollgesellschaften abheben. Zuletzt kann im Anders-Werden die möglicherweise un / zeitgemäße Situierung im Zeitgenössischen zum Thema gemacht werden.
Michaela Ott Zusammenfassung Der Beitrag untersucht, ausgehend von Gilles Deleuzes Deutung der scotistischen »Univozität des Seins«, die sich daraus ergebenden Werdens- und Personenkonzeptionen. Im Durchgang durch Schriften verschiedener Denkphasen, auch jener zusammen mit Claire Parnet und Félix Guattari verfassten, wird das Begehren des Anders-Werden dieser Philosophie selbst in den sich wandelnden Begriffen von präindividueller Quasi-Grundlegung über Entindividuierungsprozesse hin zum Unpersönlich-, Ereignis- und Ahuman-Werden des Denkens und der Person rekonstruiert. Dabei wird auch erfragt, warum trotz der Insistenz auf Prozesse des Minoritär-Werdens der zunehmenden diskriminierenden Thematisierung des Schwarz-Seins in der französischen Bevölkerung ab den 1960er Jahren keine Beachtung geschenkt wird. Abschließend wird in Erweiterung des filmanalytischen Dividuellen ein nicht nur personenbezogener Begriff der Dividuation nahegelegt.
Craig Lundy Zusammenfassung The aim of this article is to provide a full explication of Gilles Deleuze’s early engagement with Henri Bergson. Deleuze is one of the most important readers of Bergson, and Bergson is one of the most significant influences on Deleuze’s work, but the appreciation of their encounter often revolves around Deleuze’s book on Bergson. By focusing on Deleuze’s earlier writings on Bergson, without recourse to his later writings, it is hoped that an improved understanding can be gained of the genesis of Deleuze’s philosophy, and his Bergsonism in particular. After outlining the historical and philosophical context of Deleuze’s early engagements with Bergson, the majority of this article will explore the details of Deleuze’s first publications on Bergson. As we will see, the nature of being / becoming and time are integral elements of Deleuze’s early Bergson, contouring his future work, which I will touch on in the concluding section of the article.
Daniela Voss Zusammenfassung In ihrem gemeinsam verfassten Buch Tausend Plateaus (1980) entwickeln Deleuze und Guattari eine Theorie der Evolution, welche anorganische, organische und sogenannte alloplastische Schichten umfasst. Dieses ›geologische Schichtenmodell‹ impliziert jedoch keinen Gedanken von Fortschritt oder Perfektionierung. Es schließt einen aktiven evolutionären Trend hin zu einem höheren Maß an Organisation oder Komplexität aus – zugunsten nicht-teleologischer, kreativer und experimenteller Werdensprozesse. Aus ihrer Sicht liegen die positiven Ressourcen der Evolution in kontingenten Prozessen der Deterritorialisierung oder Decodierung, die komplementär zu Prozessen der Reterritorialisierung und Codierung auftreten. Dieser Aufsatz entwickelt ein Verständnis von Deleuzes und Guattaris Begriff des Werdens, anhand dessen sie die Ko-Evolution von Lebewesen und Umwelt sowie verschiedene Formen der Symbiose zwischen heterogenen Lebewesen fassen. Diese Terminologie gestattet es ihnen, entwicklungsbedingte und evolutionäre Änderungen, Ontogenese und Phylogenese als Parameter eines univoken Werdens zusammenzubringen.
Oliver Fahle Zusammenfassung Der Text beschäftigt sich mit verschiedenen Positionen und Theorien, die die Filmphilosophie von Gilles Deleuze weiterführen. Dabei rücken Filme, die ab den 1990er Jahren entstanden sind, in den Blickpunkt, da sie über den Beobachtungszeitraum der Filmbücher von Deleuze, der vom Beginn der Filmgeschichte bis in die 1980er reichte, hinausgehen. Im Zentrum steht der Bezug auf die Postkinematographie, also die Ausformung einer Ästhetik und Philosophie des Films unter digitalen Bedingungen, in denen Filme enge ästhetische Beziehungen mit anderen medialen, insbesondere audiovisuellen Formaten ausbilden. Dabei werden auch philosophische Ideen, die Deleuze nicht vollständig ausgearbeitet hat, weiter gedacht, besonders die Spannung zwischen Aktionsbild und Zeitbild; das Zeitbild und seine Relation zum Gehirn (Neuro-Image); und der Affekt und das Affektbild.
Experiment
Veronika Reichl Zusammenfassung Von 2016 bis 2022 habe ich 40 Interviews mit akademischen Philosoph:innen (von 20-jährigen Studierenden bis zu 60-jährigen Professor:innen) über ihr Lesen geführt. Diese vertraulichen, oft langen Gespräche sind die Grundlage für ein Buch mit Erzählungen über das Lesen von Philosophie. In diesen Gesprächen und den daraus entstandenen Erzählungen ging es um ästhetische und emotionale Erfahrungen beim Lesen: um Momente des Verstehens und Nicht-Verstehens, um Sinnsuchen, um die Empfindung von Bedeutung, um Einweihung in ein Feld, um das Bezwingen von Texten, um Scham, um Scheitern, um Verdachtsmomente gegenüber Texten, um das Ringen mit dem Sinn, um den Umgang mit dem akademischen Betrieb, um Berufs- und Lebenskrisen, um jahrelange Beziehungen zu Texten und darum, wie das Lesen die Menschen verändert.
Buchbesprechung
Matthias Jung Evgenia Sonnabend